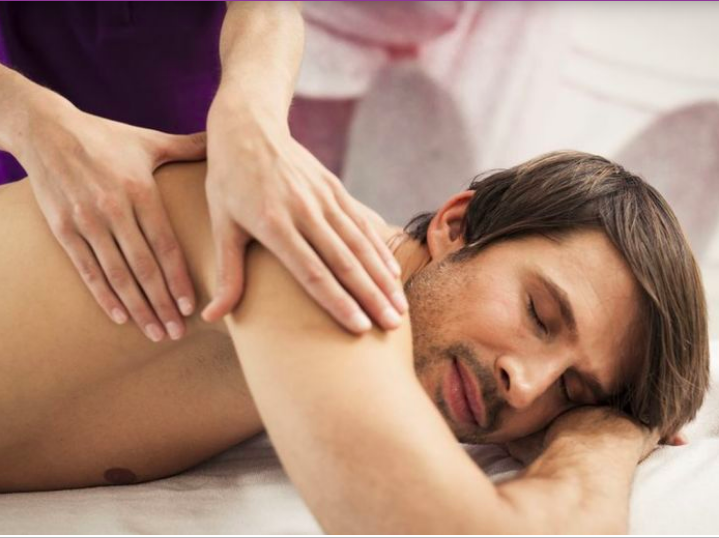Gegen Ende März und Anfang April kommt, gut versteckt, überall in Österreich der Fuchsnachwuchs zur Welt. Pünktlich zu Beginn einer neuen Fuchsgeneration stellt der Naturschutzbund die Lebensweise vom Tier des Jahres vor und gibt Tipps für ein gelingendes Zusammenleben.
Ein Wildtier – verschiedenste Lebensräume
Egal ob im entlegenen Waldstück in der Steiermark, im Wandergebiet am Hochkönig oder in einem Wiener Innenbezirk, Füchse sind überall in Österreich zu Hause. Viel mehr noch, der Rotfuchs ist der weltweit am weitesten verbreitete Vertreter der Familie der Hundeartigen (Canidae) – abgesehen vom Haushund. Er hat sich auf der gesamten nördlichen Welthalbkugel angesiedelt und fühlt sich in fast allen Lebensräumen – vom Asphalt der Großstadt bis zur Wüste – wohl. Das liegt an seiner großen Anpassungsfähigkeit, insbesondere beim Speiseplan. Je nachdem was Umgebung und Jahreszeit zu bieten haben, ernährt er sich unter anderem von Wühlmäusen, Regenwürmern, Kaninchen, Vögeln, Obst und Früchten, aber auch von Aas, Kompost oder Hausabfällen. Außer Nahrung und Wasser brauchen Füchse nur noch ruhige Orte zum Schlafen und zur Jungenaufzucht.
Anpassungskünstler Rotfuchs
Auch bei der Wahl des Baus sind Füchse flexibel – und bequem. Nicht selten nutzen sie bestehende Dachsbauten, teilweise sogar parallel zur „Familie Grimbart“, wie man den Dachs im Volksmund nennt. In diesem sogenannten „Burgfrieden“ gehen sich Fuchs und Dachs aus dem Weg und jeder hat seinen eigenen Bereich im Bau. Die Füchsin bringt im Schnitt drei bis sechs Junge zur Welt. In Gebieten mit hoher Sterblichkeit aufgrund von Bejagung oder Krankheiten können es aber auch deutlich mehr sein. Die Jungfüchse werden in der Regel die ersten acht Wochen gesäugt, bekommen aber bereits nach drei Wochen vorverdaute Nahrung. Ab der vierten Woche verlassen sie erstmals den Bau. Entgegen früherer Annahmen leben Füchse mitunter sehr sozial. Aber auch hier zeigt sich die Flexibilität des Fuchses. Von klassisch monogamen Paaren, bei denen der männliche Fuchs, der Rüde, für die Aufzucht der Jungtiere bei der Fähe bleibt und Nahrung zum Bau bringt, über polygamen Gemeinschaften bis hin zu alleinerziehenden Fuchsmüttern ist fast alles möglich.
Hühnerdieb oder Mäusefänger?
Unabhängig von der jeweiligen Konstellation stellt das Frühjahr für die Fuchsfamilie eine intensive Zeit mit hohem Nahrungsbedarf dar. Die erwachsenen Tiere sind daher teilweise auch tagsüber auf Nahrungssuche und greifen verstärkt auf leicht verfügbare Beute zu. Um ungebetenen Besuch zu vermeiden, ist es ratsam, zu dieser Jahreszeit die sichere Unterbringung von Hausgeflügel und Kaninchen besonders im Blick zu haben. Auch sollten Futterschüsseln von Katzen oder Hunden ebenso wenig frei zugänglich sein, wie Essensreste. Hungern müssen die Jungfüchse in unserer Kulturlandschaft und auch im Siedlungsraum deshalb nicht. Bei aller Flexibilität machen Wühlmäuse bei uns in der Regel den größten Anteil ihrer Nahrung aus und die vermehren sich im Gegensatz zum Rotfuchs mehrfach – drei bis sechs Mal – im Jahr.
Heimlicher Nachbar
Angst muss man vor dem Fuchs jedenfalls keine haben. Auch wenn man ihm tagsüber begegnen sollte, hat das nicht notwendigerweise etwas mit einer Krankheit oder Verhaltensänderung zu tun. Österreich ist seit 2008 tollwutfrei und solange Füchse nicht aktiv angefüttert werden, bewahren sie ihre natürliche Skepsis gegenüber Menschen und wahren Distanz. Die Übertragung vom Fuchsbandwurm auf Menschen erfolgt hauptsächlich durch Kontakt mit infizierten Fuchsexkrementen oder kontaminierten Lebensmitteln. Nach dem Sammeln von Waldbeeren oder Pilzen ist es daher ratsam, diese zu waschen beziehungsweise abzukochen und die Hände gründlich mit Seife zu waschen. Eine Begegnung mit einem Fuchs kann man mit respektvollem Abstand also durchaus entspannt genießen. Wer die notwendige Zeit und Ruhe hat, kann seine Beobachtung gerne auch auf der Naturschutzbund-Plattform www.naturbeobachtung.at oder der gleichnamigen App teilen.

Bildinfo: Der Rotfuchs ist ein Anpassungskünstler und fühlt sich vom Asphalt der Großstadt bis zur Wüste wohl. © Gabriele Hubich (o.), Pixabay (u.)